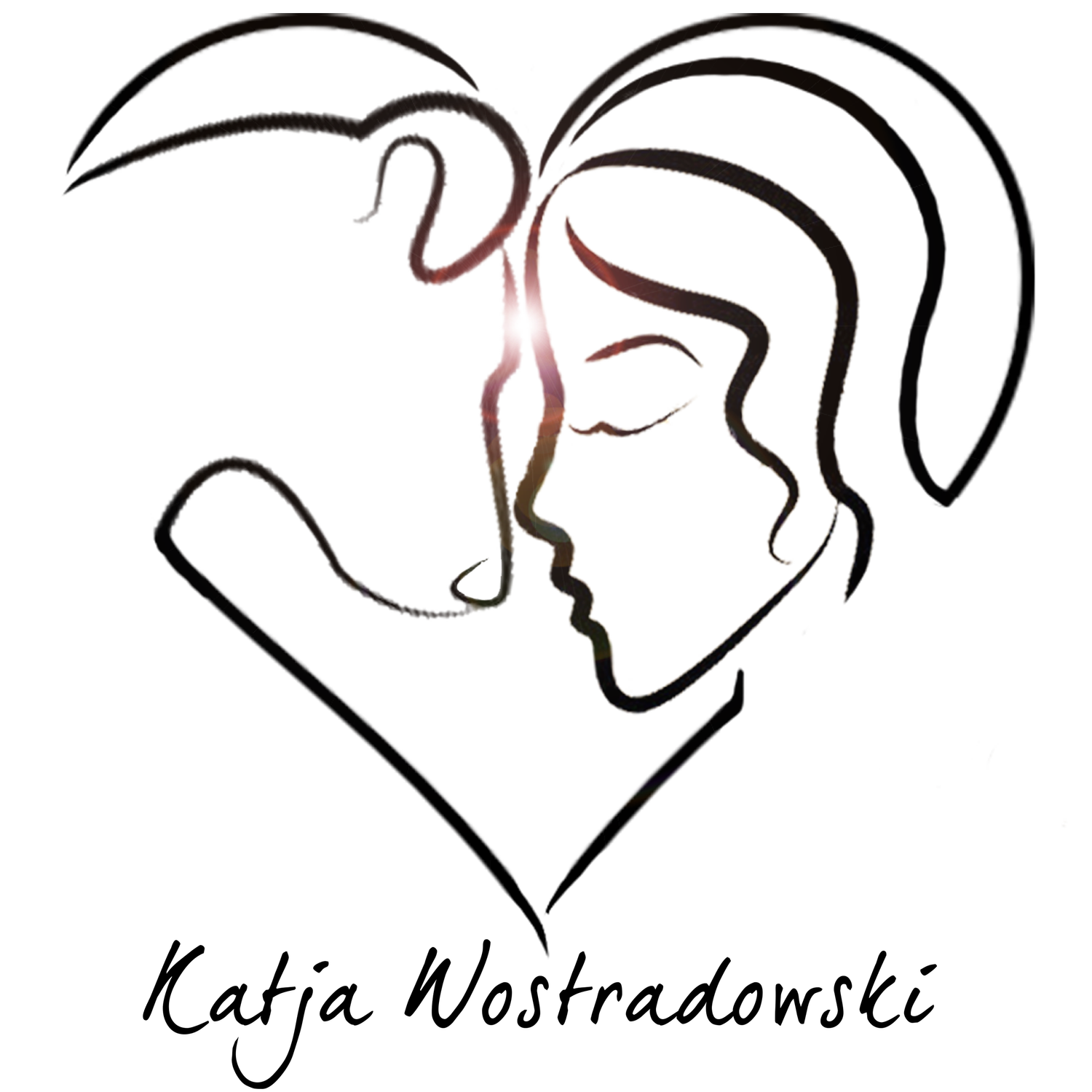In diesen Tagen, in denen wir uns an unsere Ahnen erinnern,
spüre ich das tiefe Bedürfnis, etwas mit dir zu teilen.
Vielleicht liegt es daran, dass die Schleier dünner sind,
dass wir die Stimmen jener, die vor uns kamen, deutlicher hören können.
Oder daran, dass diese Zeit uns alle auffordert,
uns zu erinnern, was wirklich trägt –
wenn das Alte bricht und das Neue sich noch nicht ganz zeigt.
Auch bei mir ist vieles in Bewegung.
Ich erlebe, wie schnell sich Vertrauen erschüttern kann,
wenn die äußere Fülle wankt.
Wie rasch Angst und Zweifel spürbar werden,
wenn Sicherheit sich auflöst.
Und genau in diesem Moment kam eine Botschaft zu mir –
klar, einfach, wahr:
„Du lebst noch im Überleben, nicht in der Fülle.“
Diese Worte trafen mich mitten ins Herz.
Denn sie erinnerten mich daran,
dass wahre Fülle nicht dort entsteht,
wo alles sicher und planbar ist,
sondern dort,
wo wir uns wieder mit dem Leben selbst verbinden.
Als ich auf meinem Feld stand
und den Mais wachsen sah –
dieses alte, heilige Symbol der Anden für Fülle und Verbundenheit –
wusste ich wieder:
Fülle ist kein Besitz.
Fülle ist ein Sein.
Die Erde nährt, auch wenn das Außen wankt.
Der Atem bleibt.
Das Leben trägt.
Und in dieser Einfachheit liegt eine stille, unzerbrechliche Fülle.
Wenn ich die Vögel sehe, wie sie ihre Nester bauen,
wenn ich meinen Körper spüre,
meinen heiligen Tempel,
wenn ich die Gitarre in den Händen halte
und den Klang in die Luft entlasse,
dann fühle ich:
Ich bin getragen.
Ich bin Teil des Ganzen.
Vielleicht ist genau das die Erinnerung,
die uns diese Zeit schenken will:
Fülle ist nicht etwas, das wir finden müssen –
sie ist etwas, das wir wieder fühlen dürfen.
Ich schreibe diesen Brief nicht aus Distanz,
sondern mitten aus meinem eigenen Prozess heraus.
Weil ich glaube,
dass wir in dieser Zeit der Transformation
einander brauchen –
um uns gemeinsam an das zu erinnern,
was uns wirklich nährt und trägt.
Mit Liebe und in Dankbarkeit
für die Erde, für unsere Ahnen,
und für das Leben selbst.